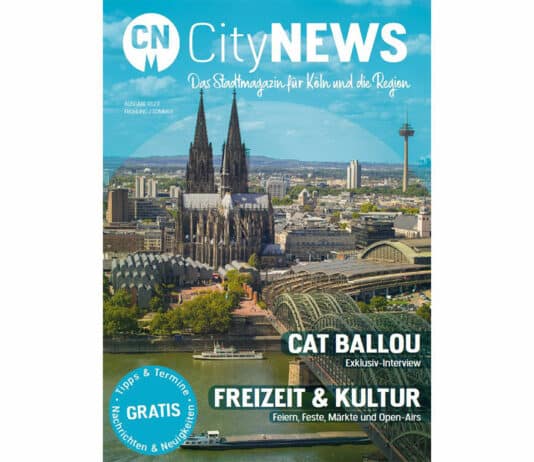copyright: CityNEWS/ Tom Pe
Der kölschen Band Bläck Fööss wurde am Montag, 23. März 2015, eine ganz besondere Ehre zuteil. Auf Einladung des Oberbürgermeisters haben sich die sieben Musiker im Rahmen eines Empfangs in das goldene Buch der Stadt Köln eingetragen.
Oberbürgermeister Jürgen Roters würdigte das große Engagement der Band für die Kölsche Sprache und das Brauchtum, ihre Heimatstadt, aber auch für das soziale Miteinander in der Stadtgesellschaft.
„Angefangen habt Ihr vor mehr als vier Jahrzehnten mit langen Haaren und nackten Füßen bei Euren Auftritten. Vieles hat sich seitdem geändert. Nicht nur, dass die Haare kürzer wurden und Ihr festes Schuhwerk bei den Auftritten tragt, auch in der Bandbesetzung gab es Wechsel. Geblieben ist aber die Freude am Gesang, die Freude an der kölschen Sprache, Eure Verbundenheit zu Köln und den Menschen, die hier leben. Eure Lieder erzählen von unserer Stadtgeschichte, vom Leben in unserer Stadt, vom Leben der Menschen mit all ihren Geschichten, Freuden und Sorgen und natürlich vom Kölner Lebensgefühl,“ so der Oberbürgermeister.
Förderung der Kölschen Sprache an Kölner Schulen
Beispielhaft sei die Förderung der Kölschen Sprache an Kölner Schulen ganz ohne Presse und Publicity. Gemeinsam mit dem Schulamt für die Stadt Köln organisieren die Bläck Fööss seit den Jahr 2000. In zahlreichen Veranstaltungen ob in Schulen oder in der Kölner Philharmonie, singen die Bläck Fööss gemeinsam mit tausenden Kindern und Jugendlichen und bringen ihnen so die kölsche Tön näher. In der Adventszeit findet regelmäßig das Weihnachtssingen im Kölner Rathaus statt.
Das Engagement der Bläck Fööss geht über die Stadtgrenzen hinaus. So unterstützten sie ebenfalls die Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaft der Stadt Köln etwa mit Bethlehem oder Kyoto. Zudem sind die Föös seit Gründung des entwicklungspolitischen Netzwerkes Eine-Welt Stadt Köln im Mai 2011 als Botschafter dabei.
Im Mai wird die Band anlässlich der 70 Jahre Kriegsende in Köln das Konzert „Usjebomb & Opjebaut“ veranstalten und so einen besonderen Betrag zur Stadtgeschichte leisten.
Laudatio von Wolfgang Oelsner auf die Bläck Fööss anlässlich deren Eintragung ins Goldene Buch der Stadt
Köln am 23.3.2015
“Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Geschätzte Angehörige, Teammitglieder und Freunde der Gruppe!
Meine Damen und Herren!
Liebe Bläck Fööss!
Unsere allererste Begegnung fand im schwarzen Anzug statt. Jedenfalls trug ich den: schwarz mit Silberkrawatte. Das war die Bühnengarderobe einer rheinischen Sitzungskapelle zu Beginn der 1970er Jahre. In der hatte ich als Trompeter Gelegenheit, mein Studium zu finanzieren. Ich kannte also den Dresscode des Karnevals: vorwiegend elegant. Eine Papierchrysantheme im Knopfloch galt schon als ekstatischer Ausreißer.
Es konnte also nicht gut gehen, wenn der Präsident als Programmpunkt sechs Jungs ankündigte, die ich schon am Bühneneingang sah, im der Outfit der 68er Jugendrevolte: Jeans und „Matte“, manche barfuß.
Es ging gut! Mehr noch: der Saal war verzückt. Nach zwei Liedern waren 1200 Herzen im Sartorysaal erobert. Und wir in der Sitzungskapelle, in der ich der Jüngste – selber mit Matte – war, ahnten, dass die Tage der Silberkrawatten gezählt waren – nicht nur im Karneval.
Wie konnte diese ganz und gar unangepasst wirkende Gruppe die Sympathien der Etablierten so rasch gewinnen? Nun, der Band gelang etwas, was jede Gesellschaft als Aufgabe zu bewältigen hat: der Spagat zwischen der Lust am Verändern – und der Sehnsucht nach Beständigem. Gleichzeitig! Der Band gelang das mit ihren Liedern.
Optisch und akustisch stand die Gruppe für Veränderung pur. Ihr Aussehen ignorierte alte Zöpfe, ihr Sound trug den Kulturschock der Beatles in die Heimatfestung Karneval, ihre Gruppen-Formation sprengte die Tradition des Einzelsängers. Doch der Inhalt ihrer Lieder erzählte vom Bewahren: „Do soll doch leever alles blieve, wie et es!“ Und das auch noch in heimatlicher Mundart. Also ausgerechnet jenen Begriffen, die der 1968er Sturm als Unwörter aus Köpfen und Zeitgeist wegfegen wollte, ignorierend, dass das Herz sie brauchte. Das Publikum spürte, was es wohl erst später verstand: Hier kommen welche, die entrümpeln und erneuern. Aber: Sie lassen die Kirche im Dorf: „Mer losse d´r Dom en Kölle“.
In einer Zeit, in der ein Modernisierungswahn sich anschickte, Veedelsstrukturen zu zerschlagen und Bindungen Marktgesetzen zu opfern, kamen da Jungs wie von der Straße in die Galaxie eines Sitzungssaals mit einer Liebeserklärung an gewachsene Sozialstrukturen, wie sie seit Ostermann nie warmherziger mehr Musik geworden war: „Mer blieve, wo mer sin, schon all die lange Johr – en uns´rem Veedel“.
Meine Damen und Herren, Menschen und Gesellschaften leiden manchmal an Zuständen, die sie selber provozieren. Manchmal stoppt erst ein gesundheitlicher oder sozialer Crash die ungute Entwicklung. Heute wird zunehmend ein Burn-outSyndrom beklagt. Früher waren Magenschwüre das klassische Beispiel, wenn jemand sich abverlangte, alles nur runterzuschlucken. Ohne zu sprechen schlägt Seelisches körperlich durch, wird psychosomatisch.
Sprachlosigkeit macht auf Dauer krank – oder aggressiv. Pülverchen können nur lindern. Heilung beginnt erst, wenn die Dinge beim Namen genannt werden. Das ist schwer genug!
Ich meine unser Kulturkreis unterschätzt, dass die sogenannte Populärkultur uns dabei auf die Sprünge helfen kann. Lieder sind ein Angebot gegen Sprachlosigkeit. Sie bieten alters- und standesübergreifend Formulierungen, Metaphern, Sprachcodes an. Die Bläck Fööss haben das nicht erfunden, aber sie haben den Menschen hierzulande geholfen, ihre ureigene Sprache wieder zu entdecken. Sie zu schätzen, weiterzuentwickeln.
Die Bläck Fööss haben sie angereichert, nutzbar gemacht – sie haben sie kultiviert. Mit ihrem immensen Repertoire – „Liedgut“ hieß es früher im Lesebuch – füllen sie eine Schatztruhe voll mit tönendem Leben. Für solch ein Geschenk kann eine Stadt, kann eine Region nicht dankbar genug sein.
Menschen anderer Regionen beneiden uns um dieses Alleinstellungsmerkmal. Denn in dieser Schatztruhe finden wir Sprachangebote für Lebensereignisse, die sonst – sei es aus Freude oder aus Trauer – nur Gefühl blieben.
Beispielsweise letzte Woche: Da machte der plötzliche Tod eines hoch geschätzten, unentbehrlichen Vereinspatrons viele in der Stadt sprachlos. In einer der Todesanzeigen fand das ohnmächtige Gefühl seinen Ausdruck in einer Liedzeile: „Wie soll dat nur wigger jon?“ Ein Zitat löst noch kein Problem. Aber – und das ist nicht wenig! – es kann uns aus verstummender Schockstarre heraus holen.
Oder 1991: Da wurden wegen des Golfkriegs alle Rosenmontagszüge im Lande abgesagt. Allein in Köln fanden Karnevalisten in zivil und Alternative zu einem gemeinsamen Spontanumzug zusammen. Zu einer Demonstration rheinischen Frohsinns gegen weltweiten Wahnsinn. Das offizielle Motto war längst ausgehebelt, da griff die Alternativszene, die der ja Heimattümelei unverdächtig ist, in die Funduskiste des Brauchtums und fand im Bläck-Fööss-Repertoire das situationsgerechte neue Motto: „Mir klääve am Lääve“.
Liedzeilen der Gruppe gehören heute zum festen Bestandteil des hiesigen Zitaten- und Metaphernschatzes. Wer das derzeitige Kölner Verkehrschaos glossieren will, kommt aus mit „links e
röm, rääts eröm“. Nicht nur ein Bild, auch eine Liedzeile kann mehr sagen als viele Worte. Unser Gedächtnis ergänzt nämlich den restlichen Text, und die mitschwingende Musik im inneren Ohr bedient das zugehörige Gefühl.
Damit kann man sich manch akademisches Wortgeklingel ersparen. Wenn Abiturienten bei der Schulentlassfeier singen „Zesammeston“, dann erreicht sie solch ein Lied oft mehr als klug gesetzte Abschiedsreden.
„Kriesch doch nit, wenn et vorbei es“. Dieses Lied begleitet seit einigen Jahren die meist tränenreiche Insignienrückgabe des Dreigestirns in der Nacht auf Aschermittwoch. Darin kommt die tröstende Zeile vor „Ohne Abschied fing nie jet Neues an“. Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse macht im berühmten Gedicht „Stufen“ eine ähnliche Aussage: „Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!“ Entscheiden Sie selber, welche Zeile im Rheinland wohl mehr Menschen erreicht.
Letzte Woche stand in der Zeitung: „Christen und Muslime singen in der Lutherkirche den ‘kölschen Stammbaum’“. Ja, Lieder der Bläck Fööss können etwas, was Kirchenlieder auch gerne möchten, was ihnen aber nicht immer gelingt: die Menschen in Kopf und Herz erreichen. Hymnen wollen das auch. Und der „Stammbaum“ ist längst zur Hymne der Integrationsbewegung geworden – in Kirchen, Sitzungssälen, auf Volksfesten und – besonders eindrucksvoll – jährlich in der Philharmonie, wenn 2000 Schulkinder vieler Herkunftsländer das gemeinsame Jahresprojekt von Fööss und Schulamt abschließen. Dafür bekamen sie vor drei Jahren den bundesweiten „Preis für gute Sprache“. Tom Buhrow hielt die Laudatio.
Meine Damen und Herren, Städte sind wie das Leben: voller Gegensätze. „Do bes en Jungfrau un en ahle Möhn“. Lieder können diese Vielfalt einfangen. Die Upper Class besingt sie ebenso wie die Klapperjass. Vorausgesetzt, die Lieder sind gut. Wie das geht? Das bleibt Geheimnis der Künstler. Ich kann nur sagen, worauf es bei den Persönlichkeiten ankommt, die diese Lieder rüberbringen.
Wer identitätsstiftende Lieder schenkt, muss selber authentisch sein. Das heißt, wissen, wovon er singt, und dahinter stehen. Bei den Fööss garantiert das der gruppeninterne „Lieder-TÜV“. Ohne den verlässt kein Werk das Studio. Und gemessen an dessen Strenge sind manche Belastungsproben von Industrieprodukten Weichspüler.
Authentizität geht verloren, wenn der Kommerz dominiert. Von dem haben sich die Fööss nicht vereinnahmen lassen. Was hätten allein die abgelehnten Werbeangebote die Bandkasse füllen können!
Auch die Verweigerung einer Bühnengarderobe gehört zur Authentizität der Gruppe. Die rote Jacke bei „Moni hat geweint“, der Frack bei „Männer“ oder die Schlafmützen beim „Mondachmorje“ sind lediglich ironisierende Requisiten. Für solche Späße sind die Fööss natürlich zu haben. Ansonsten aber kennt man sie nur so, als kämen sie gerade vom Einkaufen zurück. „Lück wie ich un do.“
Verzichtet hat die Gruppe auch weitgehend auf Hochdeutsch. Das bedeutet aber auch ein Verzicht auf eine dauerhaft überregionale oder gar internationale Karriere. Die Fööss machten längst nicht alles mit, was ihre musikalische Substanz hergegeben hätte. Wer auch nur halbwegs Kenntnis vom Innenleben einer Gruppe hat, ahnt, wie verflixt anstrengend es ist, bei Verlockungen einen Verweigerungskonsens zu erzielen. Gut, dass Ihr zu Euren Diskussionen keine Gruppentherapeuten hinzu geholt habt. Die hätten den Glauben an ihren Beruf verlieren können.
Aber: mit dieser Haltung gewinnt man auch was. Der große Astronom Kopernikus kam bekanntlich nie über seine ostpreußische Heimat hinaus. Dennoch hat er das Weltbild seiner Zeit auf den Kopf gestellt. Die Bläck Fööss hielten (ulkigerweise nach einem Stubser des Engländers Graham Bonney) an der regionalen Sprache fest – und holten Weltmusik ins Rheinland. Das war eine kreative Sauerstoffzufuhr, die nicht nur den Karneval wiederbelebte. Grenzüberwindung und Integration werden eben nicht nur durch Reisen in die Weite möglich, sondern auch bei Reisen in die Tiefen des Nahbereichs.
Eine psychologische Faustregel lautet: „Verzicht ermöglicht Beziehung.“ Und Beziehungsreichtum erlebt Ihr Fööss in unserer Region in einer beispielloser Fülle. Nicht nur, dass jeder Eure Gruppe kennt. Jeder Kölner kennt auch mindestens einen von Euch persönlich. Oder kennt zumindest einen, der einen kennt.
Diese Beziehungsnähe von Stars ohne Starkult ermöglicht etwas Besonderes. Wenn es soziologisch nicht so plausibel wäre, müsste man von einem Wunder sprechen. Das Wunderbare ist, dass nach einem Auftritt der Fööss die Welt ein klein wenig anders, meist besser, ist. Ich meine deren außermusikalisches, gesellschaftliches Engagement.
1975 habe ich das erstmals hautnah erlebt. Ich hatte damals die Leitung eines neu errichteten Internats für schwerst körperbehinderte Schüler übernommen. Mitten in einer Wohnsiedlung. Gegen die Einrichtung gab es zwar keinen lautstarken Protest, aber doch viel Reserviertheit. Am besten, man mied die so fremd erscheinende Klientel. Dann das erste Sommerfest. Unsere zwar behinderten aber sehr pfiffigen Jugendlichen hatten Euer Konzert im Senftöpfchen erlebt und Euch spontan zum bevorstehenden Sommerfest eingeladen. Ihr kamt, sangt und siegtet. Der Bann war gebrochen. Von Eurer damals jungen Bühnenpopularität sprang ein Vertrauensbonus auf die fremden Behinderten über. Die Selbstverständlichkeit Eurer Kontaktaufnahme wurde den unsicheren Nachbarn zum Modell. Noch heute heißt es in der Siedlung.
„Wann ist wieder Sommerfest? Wie können wir helfen?“
Von ähnlichen Wirkungen werden viele der Anwesenden hier berichten können. Auch diese sogenannten Sozialtermine gehören zum Selbstverständnis der Gruppe.
Bekanntlich machen nicht alle Fööss bei allen Projekten alles. Für die Wirkung ist das unerheblich. Wichtig ist, dass die Gesamtheit der Gruppe zulässt, dass die Aura ihrer Popularität die Anliegen von jenen unterstützt, die sonst kaum Gehör fänden.
Die Aura der Gruppe ist mehr als die Summe der sieben Musiker, die den Bläck Fööss auf den Bühnen das aktuelle Gesicht geben, und die sich gleich als die Herren Karl Friedrich Biermann, Ralph Gusovius, Günther Lückerath, Hartmut Prieß, Peter Schütten, Ernst Stoklosa und Andreas Wegener ins Goldene Buch der Stadt eintragen werden. Wenn der Begriff „Kultstatus“ für die Gruppe zutreffend ist, dann geht er über die Momentaufnahme vom März 2015 hinaus. „Kult“ meint hier das Ergebnis eines Gesamtkunstwerks aus 45 Jahren. Und da ist es redlich, an die zu erinnern, die zu anderen Zeiten das Bühnengesicht der Bläck Fööss mitprägten: Tommy Engel, Joko Jänisch, Rolf Lammers und Willy Schnitzler.
Ich bin mir sicher, dass die sieben, die gleich unterschreiben werden, die Genannten ebenso wenig vergessen, wie auch nicht die, die teils über Jahrzehnte hinter den Kulissen mit und für sie arbeiteten. Ich hoffe, von den „hundert“ Beteiligten keine 99 zu verprellen, wenn ich stellvertretend nur einen nenne: Hans Knipp.
Liebe Fööss! Nun steht Ihr drin – in einem Buch, gemeinsam mit den ganz Großen dieser Welt.
Wie wird man ein Großer? Auch, indem man sich klein machen kann. Nicht aus fehlendem Selbstbewusstsein, sondern, um sich in den Dienst eines Anliegens zu stellen. Ihr habt unzählige Projekte, Bewegungen, Initiativen unterstützt, ihr habt Schul- und Jugendchören den Weg auf die Bühne geebnet. Ihr habt mit „Ladysmith Black Mambazo” eine afrikanische Gruppe auf die Bühne geholt, als auf deren Kontinent noch Apartheid herrschte. Ihr seid mit Rosa Funken, Jugendchor St. Stephan, Klüngel Tropical, Schäl Sick Brass Band und vielen anderen als Bühnenpartner umhergezogen, habt Brücken gebaut zwischen Komitee-Karneval und Alternativem, zwischen Mützenträgern und Ahl Säu.
Unsummen müsste eine Stadtgemeinschaft an Mediatorenhonoraren aufbringen,
wollte man diese Effekte über politische Programme erreichen!
Mit Eurer Geschichts-CD und anderen Dokumentationen habt Ihr Aufgaben übernommen, die eigentlich einem Kulturamt zu Gesicht stünden. Und demnächst in der Flora, bei der Zeitrevue „Usjebomb & Opjebaut“ werdet Ihr fast nur Lieder anderer, früherer Komponisten singen. Meine D&H, wo im Showgeschäft stellen sich Könner aus Respekt vor der Leistung der Altvorderen noch derart in den Dienst anderer?
Im Jahr 2000 wart Ihr mit dem Jugendchor in Bethlehem. In Bethlehem kommt man zur vermuteten Geburtsstelle eines der ganz Großen unserer Kultur, nur durch eine sehr kleine Pforte. Man muss sich bücken. Altmodisch ausgedrückt heißt das: Demut zeigen.
Meine Damen und Herren! Musiker sind weder Theologen noch Politiker, weder Psychologen noch Sozialarbeiter. Ihr Mittel ist die Musik. Doch die erreicht manchmal etwas, was Theologie, Politik, Psychologie und Sozialarbeit auch gerne erreichen möchten.
Wenn eine UN-Charta heute die Einbeziehung aller Gesellschaftsschichten so bedeutungsschwer mit „Inklusion“ und „Partizipation“ umschreibt, könnt Ihr als Musiker das Anliegen mit einer einzigen Liedzeile auf den Punkt bringen: „Drink doch eine mit!“
Von einer Musikgruppe nimmt das Publikum manches bereitwilliger an, als wenn es von „den Oberen“ kommt. Authentizität, Können, nicht zuletzt Humor und immer noch ein Schuss kreativer Subkultur geben den Fööss einen Vertrauensbonus, unter dem das Publikum fast alles mitmacht. Dann singen Atheisten „O lieber Gott, gib uns Wasser“, dann schmettert das Festkomitee auf der Proklamation „Mer bruche keiner, dä uns säht, wie mer Fastelovend fiere deit!“
Schließlich: Musiker sind auch keine Therapeuten. Doch wenn es im echten Leben staut und nichts richtig läuft, dann kann ein musikalisch humorvoll inszenierter Tabubruch schon mal zu therapeutischen Effekten führen. Das jedenfalls schildert der Brief einer Erzieherin, der im Archiv der Fööss aufbewahrt wird und aus dem ich abschließend zitieren möchte.
In der Hortgruppe der jungen Frau gab es den neunjährigen Jürgen. Der hatte Schwierigkeiten mit dem Stuhlgang. Er ging nur zur Toilette, wenn jemand der Betreuer ihm dabei lustige Gedichte aufsagte.
Die Erzieherin schrieb den Bläck Fööss: „Da plötzlich hatte ich eine Idee: Ich sang ihm Euer „Kackleed“ vor. Es war wirklich die Idee – Jürgen war total begeistert. Er wollte nichts anderes mehr hören. Er riss sich jetzt darum, zur Toilette zu gehen – allerdings nur, wenn ich mitkam und ihm das „Kackleed“ sang. Ich weiß nicht, wie viel hundert Mal ich dieses Lied gesungen habe. Jürgens Hosen blieben jedenfalls von da an trocken und sauber.
Nach einiger Zeit hatte er sich daran gewöhnt, regelmäßig zur Toilette zu gehen. Und wenn ich mal keine Zeit hatte, ihm das Lied zu singen, sang er es nun selber. Es hat uns wirklich gerettet. Danke Bläck Fööss!“
Danke für Ihr Zuhören!
Wolfgang Oelsner
Autor: Redaktion / Stadt Köln