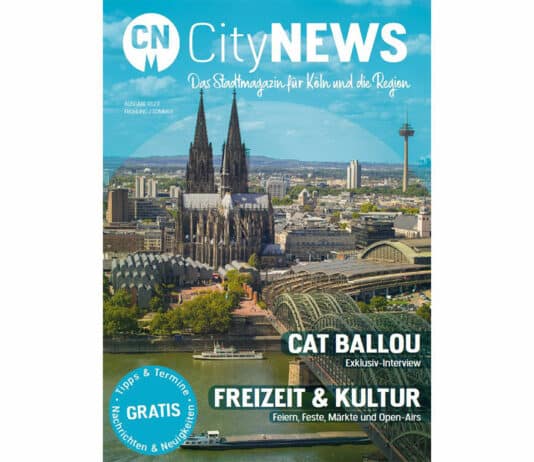Modisch und hip – und das noch billig, wenn es geht. Nach diesen Kriterien kaufen viele deutsche Kunden ihre Kleidung. Diese erhalten sie in der Regel auch, weil die Arbeiter der Fabriken ausgebeutet werden. Faire Label sind eine Alternative, die jeder nutzen sollte.
Jeder zweite Bundesbürger kauft seine Kleidung unter anderem beim Discounter ein. Für rund 90 Prozent aller Kunden ist der Preis eines der wenn nicht gar das wichtigste Kaufkriterium. Billig soll sie zwar sein, an Qualität sollte es dennoch nicht fehlen. Schließlich muss man jederzeit gut aussehen. Doch der Wunsch nach billiger, modischer Kleidung führt dazu, dass die beliebten Ketten sehr kurze Produktionszyklen von teilweise nur sechs Wochen besitzen.
Unmögliche Aufträge
Aufgrund der großen Volumina sind die Lieferanten in der Regel von ihren Auftraggebern abhängig. Diese diktieren Lieferzeiten und Preise. Die Folge: Lieferanten reichen Aufträge an Sub-Lieferanten weiter, weil sie die verlangten Mengen nicht schnell genug liefern könnten. Bei diesen Sub-Lieferanten werden die Sozialstandards häufig weniger befolgt oder unabhängig geprüft, als bei den Hauptlieferanten.
Der Kunde bekommt häufig nichts von dem Prozess mit. Er freut sich über ein T-Shirt, das ihn nur fünf Euro kostet. Dass diese genauso wenig fair und nachhaltig produziert werden wie Steaks im Fünferpack für drei Euro, ist nur Wenigen bewusst. Auf der anderen Seite ist ein hoher Preis keineswegs eine Garantie dafür, dass die jeweiligen Artikel unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen produziert wurden. Viele Luxusmarken produzieren nämlich in denselben Fabriken wie Discounter.
Was bleibt dem Kunden also übrig? Sich im Internet über verschiedene Marken und ihre Produktionsprozesse informieren und die Hersteller wählen, die ihre Kleidung fair produzieren lassen. Wer dennoch kein Vermögen ausgeben möchte, der sollte einen Blick auf Online-Outlets wie limango-outlet.de werfen. Hier kann man sich bereits jetzt mit Winter- und Skikleidung für den kommenden Winter ausrüsten – und das sogar relativ günstig.
Ausbeutung in Asien
Dass die Kleidung, die Kunden im Handel kaufen können, in Asien hergestellt wird, wissen die meisten Menschen – jedoch nicht, unter welchen Bedingungen dort teilweise gearbeitet wird. Eine Näherin in Bangladesch hat einen Lohn in Höhe von 38 Euro im Monat. Dafür arbeitet sie jeden Tag zehn Stunden. Nun fordert ein Gewerkschaftsbündnis höhere Löhne und einen besseren Brandschutz in den Fabriken des Landes. Erst vor Kurzem starben mehr als 300 Menschen bei zwei verheerenden Fabrikbränden in Pakistan. Dort wurden offenbar Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten. Aber auch die Rettungskräfte wurden von einer Katastrophe dieses Ausmaßes überrascht. Der Brand in der Textilfabrik zeigt allerdings, unter welchen fatalen Bedingungen Billigkleidung entsteht.
Beteiligungen an Brandschutzprogrammen
Tchibo, der zehntgrößte Textileinzelhändler in Deutschland, erklärte sich am Donnerstag dazu bereit, sich einem Brandschutzprogramm für Textilfabriken in Bangladesch zu beteiligen. Damit ist Tchibo nach dem US-amerikanischen Branchenriesen PVH der zweite Konzern, der sich diesem Programm anschließt. Das Problem: PVH wird das Brandschutzprogrammen nur dann durchführen, wenn sich mindestens drei weitere international bekannte Marken anschließen. Dann wird das Unternehmen, dem Marken wie Calvin Klein und Tommy Hilfiger gehören, bis zu eine Million Dollar investieren.
Das Projekt wird von Gewerkschaften und Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) aus Bangladesch unterstützt. Die Unterzeichner verpflichten sich im Vertrag, ihre Zulieferer zu nennen und von diesen zu verlangen, dass sie ihre Fabriken entsprechend ausbauen. Beschäftigte sollen geschult werden und Sicherheits- sowie Gesundheitsrisiken melden können.
Weder H&M noch die Zara-Mutter Inditex wollen bislang das Abkommen unterzeichnen. Ersteres Unternehmen begründet das Verhalten damit, dass H&M bereits über eine Million Euro in eine Aufklärungskampagne zum Thema Brandschutz investiert habe.
Gesundheitsschädliche Jeans
Nicht nur die Arbeitsbedingungen sind problematisch, auch die Fertigungsprozesse an sich können in vielen Fällen als gesundheitsschädlich bezeichnet werden. Denn damit Jeans ihren schicken Look erhalten, werden sie mit Sand bearbeitet. Textilarbeiter sterben immer wieder an den Folgen dieser Prozedur. Mindestens ein bekannter Hersteller möchte dennoch nicht auf die tödliche Technik verzichten. Ein Netzwerk von NGOs hat für ihre Kampagne für Saubere Kleidung (CCC) insgesamt 73 Textilarbeiter für ihre Studie „Deadly Denim“ interviewt. In dem Bericht wird festgestellt, dass die gesundheitsgefährliche Sandstrahltechnik in vielen Textilfabriken weiterhin genutzt wird, obwohl ihre verheerenden Folgen bestens bekannt sind. Auch in Zuliefererbetrieben für bekannte Modemarken, die sich offiziell von der Technik distanziert haben, kommt sie weiterhin zum Einsatz.
Tausende Arbeiter sind potenzielle Opfer von Lungenkrebs
Bei dem Verfahren wird der Jeansstoff mit Sand bearbeitet, um ihm den „Used-Look“ zu verpassen. Der feine Sandstaub greift die Lungen der Arbeiter an und ist aus diesem Grund in vielen Ländern verboten. In der Türkei beispielsweise war das Sandstrahlen bis März 2009 erlaubt. Hier starben den NGOs zufolge 46 Menschen an den Folgen und weitere 1.200 Krankheitsfälle wurden registriert. Die weltweite Dunkelziffer ist aufgrund fehlender Zahlen nicht feststellbar. Allein in der Türkei waren bis vor wenigen Jahren rund 10.000 Sandstrahler tätig. Von diesen sind laut CCC gut die Hälfte an der Lungenkrankheit Silikose erkrankt.
Wie funktioniert das Sandstrahlen? Es gibt grundsätzlich zwei Methoden: manuelles und mechanisches Sandstrahlen – beide können tödlich sein. Bei der ersten Methode werden Kompressoren genutzt, um Sand mit hoher Geschwindigkeit aus einer Luftpistole auf die Jeans zu schießen. Für diese Prozedur werden weder luftdichte Räume noch Ventilatoren genutzt. Die Arbeiter werden somit den feinen Silica-Partikeln ausgesetzt. Dieser feine Staub kann, wenn eingeatmet, zu Lungenkrebs führen. Obwohl diese manuelle Methode am häufigsten eingesetzt wird, weil sie eben am günstigsten ist, gibt es auch eine mechanische Methode, die weniger gefährlich sein soll. Der Studie zufolge werden die Arbeiter in Bangladesh selbst bei dem mechanischen Prozess den feinen Partikeln ausgesetzt.
Dem Bericht zufolge haben die Arbeiter in ihren Interviews bekannte Marken wie Levi’s, H&M, Esprit, Dolce & Gabbana, Zara, Lee und Diesel genannt. Bis auf Dolce & Gabbana haben in der Vergangenheit allerdings alle Unternehmen ausdrücklich bestätigt, die tödliche Technik verboten zu haben. Für Kunden ist nicht zu erkennen, mit welcher Technik die Jeans behandelt wurde.
H&M glaubt ein Vorbild zu sein
Das schwedische Textileinzelhandelsunternehmen ist über die harschen Anschuldigungen erstaunt. Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen in puncto Gesundheitsstandards als Vorreiter der Branche. Die umstrittene Technik wurde eigenen Angaben zufolge bereits 2010 aus der Produktion verbannt, so ein Sprecher von H&M. Gleichzeitig werden die Sicherheitsvorkehrungen weiterhin kontrolliert. Auch Esprit arbeitet eigenen Angaben zufolge seit mindestens zwei Jahren nicht mehr mit der umstrittenen Technik. Allen Zulieferern sei das bekannt und es werde auch sichergestellt, dass die Vorkehrungen eingehalten werden.
Illegale Arbeiten nac
h Dämmerungseinbruch
Wie die Untersuchung zeigt, wird in vielen Fabriken nachts gearbeitet, um so den Kontrollen zu entgehen. Dies zeige, dass die Kontrollen alleine nicht ausreichen. Viel mehr müssten die Unternehmen ihre Designs so ändern, dass das Sandstrahlen gar nicht mehr benötigt wird. Auch die EU müsste ein Importverbot für sandgestrahlte Produkte prüfen, so die CCC.
Ein weiteres Argument für das Verbot der Technik: Die durch die Arbeiten hervorgerufene Silikose ist eine typische Berufskrankheit bei Bergleuten. Dabei lagert sich feiner Staub in der Lunge ab. Durch die winzigen Fremdkörper bilden sich Vernarbungen und Knötchen. Die Folgen sind Husten, Atemnot und chronische Bronchitis bis hin zum Erstickungstod – eine Heilung gibt es nicht.