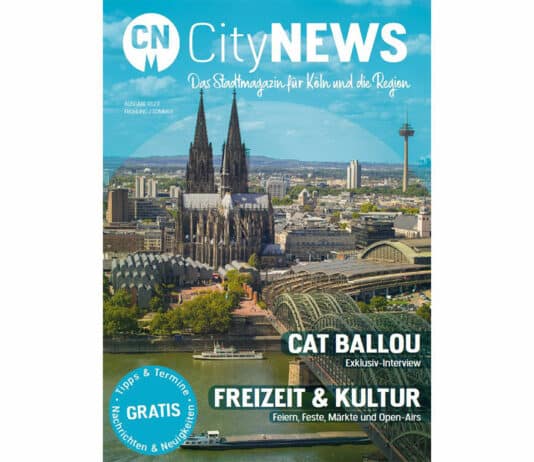copyright: Michael Gottschalk / dapd
In einem der größten Kunstfälscher-Prozesse in Deutschland sind neue Beweise aufgetaucht. Dabei handelt es sich um Kontoauszüge aus Andorra, die nun gesichtet und geprüft werden, wie der Vorsitzende Richter Wilhelm Kremer am Donnerstag zum Prozessauftakt vor dem Landgericht Köln sagte.
Angeklagte schweigen
Staatsanwältin Kathrin Franz brauchte mehr als eine Stunde, um die Anklageschrift in einem der größten Kunstfälscher-Prozesse in der deutschen Nachkriegszeit zu verlesen. Vor dem Kölner Landgericht müssen sich seit Donnerstag zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 52 bis 64 Jahren verantworten, weil sie elf bekannte expressionistische Werke gefälscht und in den internationalen Kunsthandel gebracht haben sollen.
Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbs- und bandenmäßig begangenen schweren Betrug in 14 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfälschung vor. In drei Fällen blieb es lediglich beim Versuch, die gefälschten Bilder in Umlauf zu bringen.
Durch den Verkauf der Falsifikate konnten die in Freiburg und am Niederrhein lebenden Angeklagten mindestens 15,8 Millionen Euro für sich erzielen. Den beteiligten Händlern und Käufern entstanden laut Anklage Folgeschäden von mehreren Millionen Euro. Den Vorwurf, die Angeklagten hätten mit dem Geld einen «luxuriösen Lebensstil» geführt, wies die Verteidigung jedoch zurück.
Stile und Maltechniken waren täuschend echt
Äußerst professionell und genau geplant hätten die vier Beschuldigten den «Anschein von Originalität» der Bilder vorgegeben, sagte die Staatsanwältin. So gaben die Schwestern Helene B. und Jeanette S. vor, die Bilder aus der Kunstsammlung ihres Großvaters und Unternehmers Werner Jägers erhalten zu haben. Jägers selbst soll sie von einem bekannten jüdischen Kunsthändler, Alfred Flechtheim, erworben haben. Ein anderer Angeklagter wiederum wollte die Kunstwerke aus der Sammlung seines Großvaters Wilhelm Knops geerbt haben.
Der vierte Angeklagte, der Ehemann von Helene B., wird beschuldigt, die Gemälde selbst angefertigt zu haben oder erstellen zu lassen. Dabei soll er die chemische Zusammensetzung der Farben und der Leinwände der expressionistischen Epoche sehr genau studiert haben. Auch die Stile und Maltechniken der Epoche sollen täuschend echt gewesen sein.
Werke von Max Ernst und Max Pechstein
Bei den Gemälden handelt es sich um Fälschungen expressionistischer Künstler aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie Max Pechstein, Max Ernst, Heinrich Campendonk, André Derain und Fernand Léger. Die Titel der Falsifikate waren teilweise frei erfunden. Anderen Malereien wurden Titel aus vorhandenen Werkverzeichnissen gegeben. Dabei machte sich das Quartett den Umstand zunutze, dass die Werke zwar in den entsprechenden Verzeichnissen und Katalogen genannt wurden, sie aber als verschollen galten und daher keine Abbildungen von ihnen bekannt waren.
Schließlich bediente sich das Quartett kunsthistorischer Labels, Stempel und Aufkleber, die auf der Rückseite der gefälschten Bilder angebracht wurden. Das schließlich wurde ihnen zum Verhängnis. Zwar waren bereits mehrfach von Gutachtern Zweifel an der Echtheit der Bilder geäußert worden. Doch erst, als eine Kunsthistorikerin die als Echtheitszertifikate nachgeahmten Aufkleber auf der Rückseite vieler Bilder als Fälschung einstufte und sich dies von einem Flechtheim-Experten bestätigen ließ, flog der Millionenschwindel auf.
Geld floss ins Ausland
Das bis dahin erzielte Geld floss größtenteils ins Ausland auf mindestens ein Konto in Andorra. Die entsprechenden Kontoauszüge wurden in den vergangenen Tagen an das Amtsgericht Köln übergeben, wie der Vorsitzende Richter Wilhelm Kremer zum Ende des ersten Prozesstages bekannt gab. Diese und weitere Dokumente werden mit in den Prozess aufgenommen, müssen aber zum Teil noch übersetzt werden.
Der Prozess soll am 21. September fortgesetzt werden. Das Urteil wird im März 2012 erwartet.
Autor: Redaktion / dapd / http://bvap.de